10. Sept. – 22. Okt. 2011
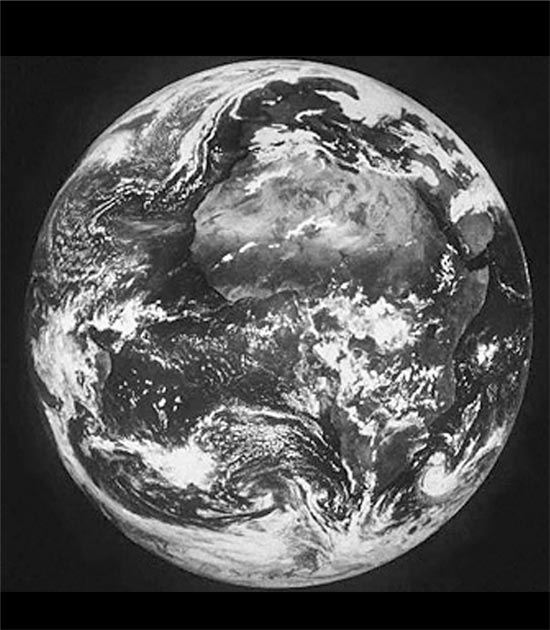
Für LOBGESANG IM ANACHRON verwandelt Svenja Kreh ZERO FOLD in einen Andachtsraum. Der Besucher betritt einen Ort spiritueller Atmosphäre, an der altarähnlich aufgegliederten rechten Wandfläche sind kleinformatige schwarze Tuschzeichnungen auf Papier angebracht. Deren Bildaufbau erinnert an frühchristliche Darstellungen und ihre Montage auf Holz stellt schon materiell eine Verwandtschaft zu byzantinischer Ikonenmalerei her.
Der Ausstellungstitel setzt sich zusammen aus den Titeln zweier Zukunftserzählungen: Der erste Part bezieht sich auf Lobgesang auf Leibowitz des Autoren Walter M. Miller jr., einen der ersten sog. Post-Doom-Romane und Beschreibung möglicher Zustände nach einem Atomschlag. Die namengebende Hauptfigur, einer der wenigen Überlebenden, gründet einen Orden, der die Reste an Texten und Belegen ehemaligen Wissens akribisch archiviert. Der zweite Teil nimmt Bezug auf die Kurzgeschichte Allein im Anachron von Cordwainer Smith, die schildert, wie sich ein Wissenschaftler freiwillig mutterseelenallein einer Raum-Zeit-Anomalie aussetzt.
Der Betrachter vollzieht das vergleichbar eremitische Tun der Künstlerin als ein Leibowitz oder ein Hieronymus im Gehäus bei der Erstellung ihrer komplexen Zeichnungen nach, die ihm ebenfalls abverlangen, sie in einem sehr konzentrierten, fast kontemplativen Akt des Sehens zu erschließen.
Die Bildräume erscheinen im Vergleich zu früheren großformatigen Arbeiten Krehs gegliederter, der nahezu symmetrische Aufbau aus architektonischen Versatzstücken gibt vermeintlich ein festes räumliches Ordnungssystem vor. In tiefer Skepsis gegenüber dem mechanistischen Denken und allen daraus generierten Ordnungsinstrumentarien und Erkenntnissystemen der Zivilisation verweigert die Künstlerin aber ein fixes Bedeutungssystem. Die Orientierungssuche des Betrachters im Bild, in dem sich Zeit- und Raumebenen verschachtelt zeigen, es zu Überlagerungen der Bildschichten, zu Perspektivverschiebungen und wechselnder bildsprachlicher Kohärenz kommt, ist adäquat zu einer anhaltenden geistigen Suche: Alle wissenschaftlichen Spekulationen über das Universum haben nicht zur letztgültigen Beantwortung der Fragen über das Woher und Wohin geführt.
Die Konvention der Zentralperspektive, einen hierarchischen Blick zu konstruieren und damit die Darstellung der realen Seherfahrung scheinbar perfekt anzugleichen, nutzt die Künstlerin als haltgebende Gegenposition zur immer weiter fortschreitenden Post-Pop-globalisierten Indifferenz und dem damit einhergehenden Verlust an Individualität. Gleichzeitig stellt Kreh sie wieder infrage, indem sie den statischen, bühnenartigen Bildraum dynamisiert und vor der strukturierten Folie ein Geflecht von Motiven entfaltet, die sich wechselseitig überblenden und den Blick zum Kippen bringen wie auf einer Grafik von M.C. Escher. Er wird bevölkert von mystischen Naturwesen, mehr oder weniger Vertrauen erweckenden Stellvertretern für Heilsversprechen, Kugeln, Rädern und Symbolen vorsprachlicher Weisheit, durchzogen von organischen und anorganischen Röhren: das Universum als permanenter Energieaustausch, Organismus und Logos, die Wirklichkeit als niemals einheitlich erfahrbar.
In Svenja Krehs Bildwelten herrscht eine ambivalente Stimmung von Geborgenheit und Bedrohung: Schächte und unbestimmte Zonen von Dunkelheit bieten Verstecke, Zufluchten, Rückzugsorte an. Ihnen eignet aber auch eine Grundbefindlichkeit der Verlorenheit und des Nicht-Zuhause-Seins in dieser Welt, einer Angst im Sinne Heideggers, in der sich der Mensch nicht vor etwas Konkretem fürchtet, sondern mit dem Nichts und Nirgends seines Daseinsgrundes konfrontiert ist, wie der Protagonist in Cordwainer Smith Erzählung, der sich zum Schluss in einen schwarzen Abgrund stürzt, in dem Zeit und Raum aufgehoben sind.
Den Betrachter erfasst vor den Zeichnungen Svenja Krehs, was der Theologe Rudolf Otto als mysterium tremendum beschreibt: die unmittelbare, noch nicht reflektierte Form eines beängstigenden Gefühls des Unheimlichen, das, neben Faszination und Vertrauen, einen nicht genau ableitbaren Bestandteil der Erfahrung des Numinosen ausmacht. Nicht ganz klar ist, beschleicht den Betrachter diese Empfindung angesichts der rückwärtsgewandten Zukunftsvisionen in einer Post- oder Präapokalypse? Bei Miller schließt sich der Kreis am Ende des Romans und die Schilderung der 2000 Jahre nach dem Atomkrieg entpuppt sich als identisch mit den zwei Millennien davor: Die Menschheit lernt nichts aus ihren Fehlern.










